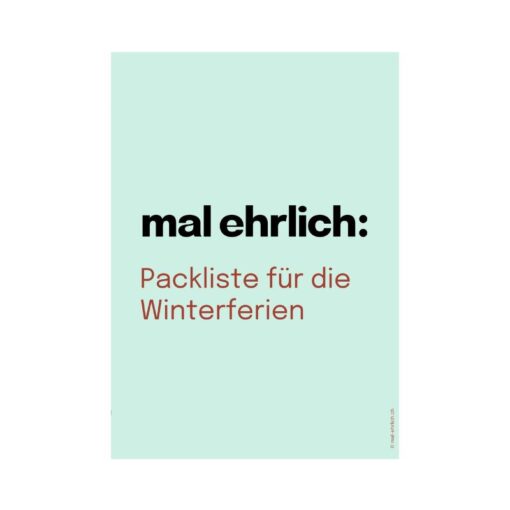Die heilige Kuh – Kritik an der Schule
Das öffentliche Bildungssystem infrage zu stellen, kommt ähnlich gut an, wie Roger Federer ins Gesicht zu spucken: Nicht so gut. Andrea tut’s trotzdem.

Mein Sohn kommt bald in die Primarschule. Laut Stichtag wäre es der 20. August 2018, nach der Kindergärtnerin warten wir lieber noch ein Jahr, obwohl der Sohn viele Kindergartenkompetenzen laut Lehrplan schon ganz prima meistert: «Das Kind» kann beispielsweise «verschiedene Werkzeuge wie Schere, Farbstifte usw. zweckmässig führen» oder «es beherrscht motorische Fertigkeiten wie zum Beispiel die Rolle vorwärts». Das freut mich natürlich schampar.
Ich war zugleich Musterschülerin und ein Musterbeispiel für ein Kind, dem man das Lernen verleidet.
In anderen Dingen gibt’s noch Luft nach oben. Wie oft hätte ich mir bei meinen erwachsenen Mitmenschen schon gewünscht, dass mein Gegenüber «Erlebnisse, Anliegen, Gefühle und Ansichten so mitteilen würde, dass seine Erfahrungen für andere nachvollziehbar werden, dies in verbaler, nonverbaler und symbolisierter Form». Der Grundstein für eine erfolgreiche Paarbeziehung wird also bereits im Kindergarten gelegt. Spitz ja die Ohren, mein Sohn, während du deine Hechtrollen übst!

Die Auseinandersetzung mit dem Ernst des Lebens hat bei mir neben dem «Wann» noch andere Fragen aufgeworfen. Ich erinnere mich an den eigenen Chrampf, die Jahre, in denen ich vor lauter Prüfungsangst nicht schlafen konnte, in denen mir ein Viereinhalber den Tag versauen konnte und an die vielen Stunden, in denen ich mir Wissen in den Kopf stopfte, das ich am nächsten Tag erbrach und damit für immer vergass. Ich war zugleich Musterschülerin und ein Musterbeispiel für ein Kind, dem man das Lernen verleidet.
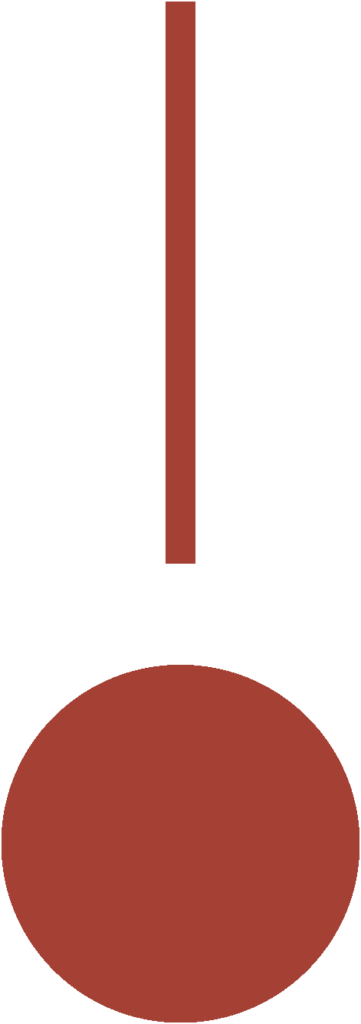
Wir werden diesen Beitrag noch aufbretzeln für unsere neue Webseite. Drum sieht momentan nicht alles rund aus. Aber mal ehrlich: gut genug. Danke für deine Geduld!
Da hat sich einiges getan, aber.
Eine subjektive Erfahrung, selbstverständlich, die ich aber meinen Kindern ersparen möchte. Ich fing also an, mich über den Status Quo in Sachen Volksschule in der Schweiz schlauzumachen. Und merkte: Da hat sich seit meiner Zeit einiges getan. Kompetenzen werden gefördert anstatt starres Wissen vermittelt, der Frontalunterricht ist nicht mehr das Mass aller Dinge und vielerorts gibt es altersübergreifende Stufen.
Aber: Vieles ist auch gleich geblieben, seit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht anno 1874. Die Schule hatte in der Zeit der Industrialisierung vor allem die Vermittlung bürgerlicher Werte zum Ziel und auch: die Ehrerbietung gegenüber höher Gestellten. Die Kinder sollten folgen lernen, gute Arbeiter werden. Bewertet wurde mit Noten, so wie heute. Wer die Norm nicht erreicht – auch heute noch –, fällt durch oder fast noch schlimmer, langweilt sich ins Desinteresse.
Genau hier harzt es mit meinem Verständnis für die Volksschule. Warum muss Gelerntes numerisch «genügen» – sollte es nicht primär interessieren? Sind Kinder nicht von Natur aus neugierig, haben das intrinsische Bedürfnis, sich Wissen anzueignen, aber womöglich nicht von acht bis neun oder in einem begrenzten Zeitrahmen einer 45-Minuten-Lektion?
Wie kann die Auffassung Bestand haben, dass jedes Kind die gleichen Fähigkeiten mitbringen sollte? Wo ist der Raum für Individualität und Kreativität, die den aktuellen Zeitgeist sonst überall prägen? Warum erziehen wir faktisch weiterhin Arbeiter, wenn das automatisierte Handeln in Zukunft Maschinen übernehmen werden und wir Menschen brauchen, die querdenken können?
Als hätte ich Roger Federer ins Gesicht gespuckt
Es sind Fragen, die selbstverständlich nicht nur ich mir stelle, sondern Vordenker wie beispielsweise der deutsche Philosoph Richard David Precht oder die Schweizer Kinderarztkoryphäe Remo Largo, aus deren Argumentation ich mich bediene. Was mich erstaunt: Es sind auch Fragen, die angreifen und andere persönlich treffen. Mehr als einmal musste ich schon merken: Die Kritik am Bildungssystem der Schweiz trifft ins Innerste – nicht selten endeten Gespräche in heftigen Diskussionen. Die Schule, sie ist eine heilige Kuh.
Als hätte ich Roger Federer ins Gesicht gespuckt, so schauen sie mich an, die Eltern von Schulkindern, denen ich die Sinnfrage stelle. Mein Rütteln an ihrem Weltbild kontern sie mit «aber er geht ja meistens gerne hin!», der Wunsch nach mehr Freiheit wird quittiert mit «da müssen sie halt durch».
Aus dem Streitgespräch entferne ich mich dann jeweils gerne mit einer seit Kindergarten perfektionierten Hechtrolle. Und flüstere, in sicherer Distanz, ganz leise: «Aber wozu?»
Dieser Beitrag erschien erstmals als Kolumne bei WirEltern.
Gastautorin Nicole Simmen ist mit meiner Meinung überhaupt nicht einverstanden. Als überzeugter Volksschul-Fan hat sie einen Konter geschrieben auf diesen Text, hier zu lesen: «Bisch sicher? – Eine Antwort auf Andrea Jansen’s Schulkritik». Lesen.
Ebenfalls mit dem Thema alternative Schulen befasst sich der Beitrag «Freilernen – Schule ohne Druck», inklusive einer Liste von freien oder demokratischen Schulen in der Schweiz.
Zur Kritik am Schulsystem hat auch Gastautorin Marah Rikli Stellung genommen: «Stellungnahme zum Leitfaden für die Primarschule» und sie findet ebenfalls: «Yoga gehört in die Schule».
Und wie es sich anfühlt, das Kind zum ersten Mal gehen zu lassen: «Loslassen».
Informationen zum Beitrag
Dieser Beitrag erschien erstmals am 14. August 2018 bei Any Working Mom, auf www.anyworkingmom.com. Any Working Mom existierte von 2016 bis 2024. Seit März 2024 heissen wir mal ehrlich und sind auf www.mal-ehrlich.ch zu finden.
1x pro Woche persönlich und kompakt im mal ehrlich Mail.